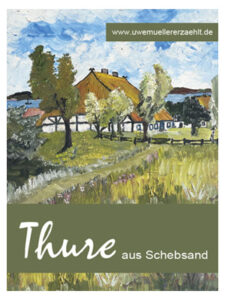
THURE-22.04.01
DER ALBTRAUM
Thure Hansen saß auf den Schienen, mitten auf einer freien Zugstrecke. Er war an Händen und Füssen mit Eisenketten an die Gleise gefesselt und konnte sich kaum bewegen.
Es regnete und es schien, als würden sich Bäche von herabstürzendem Wasser auf ihm ergießen.
Aus der Ferne ertöntes ein schrilles Signal, das Thure zusätzlich erschaudern ließ.
Die Lichtkegel der herannahenden Lokomotive stachen durch die Dunkelheit hindurch und nahmen eine gespenstische Größe an, je näher sie kamen.
„Hilfe, bitte helft mir“, schrie Thure. Aber niemand hörte ihn.
Und so kam, was kommen musste. Der Zug kam näher und Thure fügte sich in sein unausweichliches Schicksal.
Als die Waggons mit unbarmherziger Härte heranratterten, da bewegten sich hinter ihm die Weichen mit einem knackenden und quietschenden Geräusch und schoben den herandonnernden Zug auf die parallel verlaufenden Gleise.
Die Waggons schossen an Thure mit einem ohrenbetäubenden Lärm vorbei, wie von einer unsichtbaren Kraft geleitet.
Thure spürte plötzlich eine Hand, die auf ihm lag.
„Warum schreist du so?“, fragte Maria ihn, nachdem er schweißgebadet aufgewacht war.
„Ach nichts!“, murmelte Thure.
„Die Drogenmafia hat mich auf den Gleisen angekettet. Es gab kein Entrinnen.“
„Du guckst zu viele brutale Filme“, sagte Maria zu ihm, drehte sich um und versuchte weiterzuschlafen.
Thure war froh, dass seine Frau ihn aus diesem Albtraum erlöst hatte.
Er stand auf und schlurfte ins Bad, um sein Gesicht ein wenig zu benetzen.
Obwohl es erst kurz nach drei Uhr war, wollte er aufbleiben.
Bei Thure, im Grunde genommen froh, dem vermeintlichen Unglück entronnen zu sein, stellte sich dennoch keine wirkliche Freude ein.
Ihm kam der Krieg in der Ukraine wieder ins Bewusstsein.
War die Realität etwa noch schlimmer als das, was er gerade geträumt hatte?
Er versuchte an etwas Schönes zu denken.
Gestern hatte er mit Emma, seiner vierjährigen Enkelin auf dem Sofa gesessen und sie hatten Angeln gespielt.
Thure sollte für Emma mit der Angel eine Krone aus dem Wasser fischen, die sie dort verloren hatte.
„Opa, du musst an der Kurbel drehen“, rief Emma. Sie war mit Energie und Phantasie bei dem Spiel.
‚Was für ein glücklicher Moment‘, dachte Thure.
Er hatte für die Kleine einen Strand aus Worten gemalt, mitten auf seiner Lieblingsinsel Rügen, und sie tauchten die Angel in das Wasser, um die Krone zu finden und vielleicht sogar eine Kiste mit Gold.
„Oh, das wird ja immer schwerer. Schau mal, wie sich die Angelschnur biegt. Hoffentlich reißt sie nicht“, schnaufte Thure.
„Mach schnell, Opa!“
Emma hielt es nicht mehr auf der Couch. Sie kroch vom Sitz herunter und kletterte auf die Seitenwand, um sich nach vorn zu beugen, so, als würde sie an der Angelschnur mitziehen können.
„Ach du lieber Gott“, fluchte Thure.
„Es ist ein alter, dreckiger und stinkender Teppich. Wer hat denn den da reingeschmissen?“
Thure spielte seine Enttäuschung so echt, dass Emma in glucksendes Lachen ausbrach.
Ihre Zähne blitzen, ihre Augen funkelten und sie klatschte vor Begeisterung in die Hände.
„Los Opa, noch mal“, feuerte sie Thure an, der die vermeintliche Angel in der Hand drehte und mit noch größerem Schwung und unter großem Beifall von Emma wieder in das Wasser warf.
„So Emma, wir müssen nach Hause fahren“, sagte Emmas Mama, die unbemerkt ins Wohnzimmer gekommen war.
„Ich bleib’ bei Opa. Wir müssen noch die Krone finden“, sagte Emma und spornte Thure an.
„Machen wir weiter, Opa.“
Thure musste nun schmunzeln, als er sich an die schönen Momente mit Emma erinnerte und gleich wieder traurig wurde. Es könnte alles so schön sein. Wäre da nur nicht dieser furchtbare Gedanke an den Krieg in der Ukraine.
Schon ein wenig munterer befeuchtete Thure weiter seine Lippen und die Augen mit ein paar Spritzern Wassern.
‚Warum stand er so früh auf, war es etwa senile Bettflucht?‘, schoss es ihm durch den Kopf, als er sein zerknittertes Gesicht im Spiegel betrachtete.
Nein, das war es wohl nicht. Er fühlte sich von etwas Unsichtbarem getrieben, etwas, das ihn sein ganzes Leben in Trab gehalten hatte – der ungläubige Wille, noch etwas Sinnvolles zu schaffen.
„Ich muss um vier Uhr aufstehen, sonst schaffe ich mein Pensum nicht“, sagte er zu seiner Frau, die nur die Augen verdrehte.
„Du bist Rentner“, versuchte sie ihn auf den Boden der Tatsachen zu holen, aber davon wollte Thure nichts wissen, und so prallten die Worte an ihm ab.
Thure machte Sport. Fast jeden Tag lief er früh durchs Dorf, genau dann, wenn die anderen Bewohner noch schliefen und nicht sehen konnten, wenn er seine Stöcke in den Boden rammte und dabei schnaufte, als würde er eine Lokomotive hinter sich her schleifen.
Morgens war es für ihn am schönsten. Er konnte in die Wiesen schauen, auf denen noch der Nebel lag und nur langsam aufstieg, und er lief an den Häusern vorbei, in denen nur selten bereits Licht brannte.
Thure liebte sein Dorf und manchmal hasste er es auch, obwohl er nun schon fast dreißig Jahre dort wohnte.
Es war so ein Gefühl, dass er nicht wirklich dazugehörte, sich woanders hinsehnte, nach Schwerin zum Beispiel oder nach Rügen, seine geliebte Insel.
Aber nun war er in Brandenburg, wurde dort wahrscheinlich begraben und die Dorfbewohner würden auf der Beerdigungsfeier wahrscheinlich sagen, dass er eigentlich gar nicht von hier war, ein Fremder eben.

MEHR LESEN:
