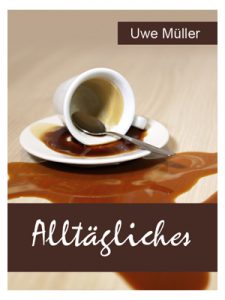
Aufgeschrieben im August des vergangenen Jahres.
WELCHE HALTUNG BEIM LESEN DER BIBEL EINNEHMEN
Mich von meinen eigenen Gefühlen beim Lesen der Bibel leiten lassen, die Worte persönlich nehmen, sie an meinen Verstand und an mein Herz heranlassen.
Ich taste mich weiter vor, denke darüber nach, wie ich am besten mit dem Lesen dieses biblischen Stoffes anfangen soll.
„Lieber unvollkommen begonnen, als perfekt gezögert“, hat mir mal jemand gesagt.
Da ist was dran. Trotzdem will ich mich natürlich nicht reinstürzen in die unbekannte Materie, sondern mir einen Weg selbst bauen, einen Pfad, auf dem ich entlanggehen kann und wo an den Rändern vielleicht so etwas wie Leitplanken sind, die mich führen.
Ich lese, was Anselm Grün dazu schreibt. Der sollte es wissen, schließlich ist er nicht nur promovierter Theologe, sondern auch praktizierender Benediktinermönch. (Anselm Grün, Die Bibel verstehen, E-Book, ISBN – 978-3-451-33627-0, Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010, Einladung).
Schon in seiner „Einladung“ zum Buch schreibt er, dass ich mich so fühlen soll, als würde Gott sich mit seinen Worten direkt an mich persönlich wenden.
Also, ich halte ja eine ganze Menge von mir, aber das ist wohl eine Hausnummer zu groß für mich, nämlich so zu tun, als würde Gott sich direkt an mich wenden.
Aber gibt es nicht auch das Gefühl, wo du dich unter Tausenden von Leuten befindest, auf der Bühne vor dir jemand redet und du denkst: „Donnerwetter, der schaut nur mich an, und meint wahrscheinlich auch mich?“
Und schon fängst du an, ihm zustimmend zuzunicken, ihm Mut zu machen, dass er etwas ganz Wichtiges von dort oben sagen würde.
Oder ich lese gerade das Buch des Extremsportlers Jan Frodeno.
Wenn er davon berichtet, wie hart es ist, sich jeden Tag zu überwinden, die Härte des Trainings auf sich zu nehmen, dann antworte ich ihm im Stillen: „Du, ich kenn‘ das, wenn ich morgens an der Bizepsmaschine sitze und ‚Null Bock‘ habe, anzufangen, aber ich fange trotzdem an.“
Solche Sachen sage ich zu mir und denke hinterher: „Na mein kleiner Dicker, wenn der deinen Bauch sehen würde, der würde dir kein Wort glauben.“
Egal, so jedenfalls muss das funktionieren mit dem persönlichen Wort, das nur an dich gerichtet ist.
Jedenfalls ist das eine der drei Haltungen, die der Benediktinermönch empfiehlt beim Lesen der Bibel einzunehmen. (Vgl. ebenda).
Außerdem empfiehlt er, „die Worte oder Bilder für mein Leben und als Bilder für Gottes Wirken an mir zu verstehen.“ (Vgl. ebenda)
Damit kann ich mich gut anfreunden.
Ich habe mal Jemandem gesagt, der mich gefragt hat, warum ich nicht an Gott glaube, dass ich vor allem an mich glauben würde.
In dem Fall wäre ja Gott in mir.
Damit kann ich leben, das ergibt Sinn für mich. Gott ist nicht nur über, er ist vor allem in mir.
Also kann ich seine Worte direkt auf mein ganz praktisches Leben beziehen, Kraft daraus ziehen. Nicht schlecht. Gefällt mir.
Und eine dritte Haltung beschreibt Anselm Grün so: „Die Worte der Bibel sind Worte des Lebens. Die Worte wollen… einladen, barmherzig und freundlich mit mir umzugehen.“ (Vgl. ebenda)
Da kann ich gar nicht anders, als zuzustimmen.
DIE FASZINATION WÄCHST
Je mehr ich mich an die unbekannten Texte herantaste, umso mehr üben sie einen Sog auf mich aus.
Mein Vater hat mich ein Leben lang anders erzogen, nämlich nicht an Gott zu glauben. Als ich einmal in Dresden nach Hause kam und ihm berichtete, dass ich mit einem Pfarrer gesprochen hätte, und ihn gefragt hatte, ob ich auch mal auf der Kanzel stehen könnte, da ist er bald ausgerastet.
Ich bin dann noch einmal in die Kirche gegangen, habe mich umgeschaut, zugehört. Aber das war’s schon.
Im vergangenen Jahr, da war mein Vater schon todkrank, er lag quasi auf dem Sterbebett, ausgerechnet in einem katholischen Krankenhaus.
„Die sind hier so gut zu mir, so freundlich und entgegenkommend, das glaubst du nicht“, sagte er zu mir.
Das Wort „barmherzig“ hätte hier gepasst, aber das widerstrebte ihm, es in den Mund zu nehmen.
DAS ERSTE KONSPEKT AUS DER STUTTGARTER ERKLÄRUNGSBIBEL
DIE REISE IN DIE BIBELWELT BEGINNT
Gestern war mein erster Urlaubstag und ich habe ihn damit begonnen, dass ich mich in die Bibel vertieft habe; besser in die ‚Stuttgarter Erklärungsbibel‘, die Luthers Bibelübersetzungen und Erläuterungen dazu enthält.
Es wird wohl mein letztes großes Projekt sein, dass ich auf diesem Erdball beginne, besser auf meiner kleinen Scholle, auf der ich mich befinde.
Ich will mich geistig nicht einengen, nicht abhängig sein von irgendwelchen Glaubenssätzen.
Und genau deshalb glaube ich daran, dass ich die Bibel lesen muss.
Werde ich dadurch gläubig?
Wohl nicht. Kann ich danach an Gott glauben?
Wohl kaum. Kann ich glauben, dass Gott in mir ist. Naja, schon eher.
Ich weiß nicht, wohin mich die Reise führen wird, aber ich finde sie enorm spannend.
Ich werde es ohne Hilfe nicht schaffen. Mein schönstes Geburtstagsgeschenk in der vergangenen Woche war die ‚Stuttgarter Erklärungsbibel‘.
Sie soll mir helfen, die oft schwierigen Zusammenhänge zu verstehen, damit ich so nah wie möglich an das Bibelwort herankomme.
Ich schreibe mit Tinte und Papier, besser, ich konspektiere mit der Hand, wenn es schwierig wird.
Ich weiß noch, wie ich das ‚Kapital‘ studiert habe. Die meisten, die darüber reden, haben es nie gelesen. Auch im Osten nicht. Ich habe mich da durch die vier Bände gequält.
Ich weiß also, welches Werk Marx da geschaffen hat, und wo er geirrt hat. Das ist etwas ganz anderes, als nur aus irgendeiner vermeintlichen ideologischen Ecke seinen ‚Senf‘ dazuzugeben, ohne wirklich zu wissen, worüber man spricht.
Ich will das Wort der Bibel auf mich wirken lassen und sehen, was ich damit anfangen kann.
Später kann ich es immer noch einordnen, ablehnen oder es endgültig zu lassen.
Klar, ich werde es nicht schaffen, alles zu verstehen, die geschichtlichen Zusammenhänge begreifen, die vor über 1000 Jahren aufgeschrieben wurden. Aber ehrlich, das macht es doch so interessant.
Das treibt mich, es zu erforschen und für meine Lebensphilosophie anzuwenden.













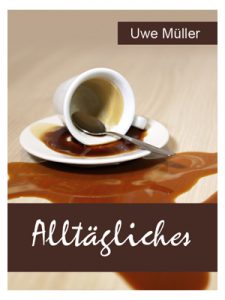

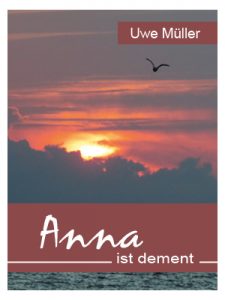

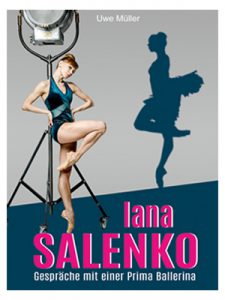

 WAS VOM TAG HÄNGEN BLEIBT
ALLTÄGLICHES (83)
WAS VOM TAG HÄNGEN BLEIBT
ALLTÄGLICHES (83)


