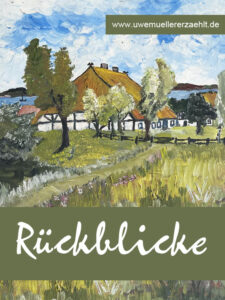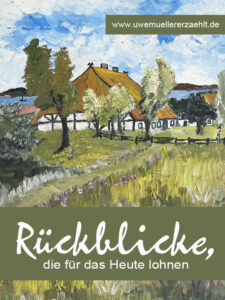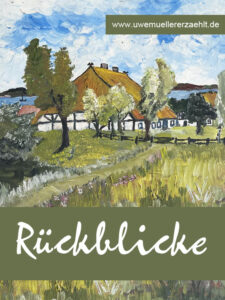
MENSCHEN IM ALLTAG – 2021.07.14
INTERVIEW MIT VERA TOMASCHEWSKI
INTRO:
Vera Tomaschewski ist Versicherungsfachfrau (BWV). Der Sitz ihrer Hauptvertretung – AXA-Versicherung AG – ist Bad Freienwalde, dort, wo sie auch mit ihrer Familie Zuhause ist.
Ich habe sie am 22.06.2021 interviewt.
Es hat ausgesprochen Spaß gemacht, mit Vera Tomaschewski zu reden, und nicht nur das, sondern auch ihr zuzuhören, was sie zu sagen hat.
Sie hat viel zu erzählen – von ihrem Beruf, den sie liebt, von ihrem Werdegang, der nicht ohne Rückschläge und Konflikte verlief.
Vera Tomaschewski machte auf mich am Telefon einen sympathischen und in sich ruhenden Eindruck.
Doch sie hat durchaus Humor, kann selber gut zuhören, darauf achten, was den anderen bewegt.
Du spürst, dass du dich öffnen kannst, ihr einfach sagen solltest, was dich im Leben umtreibt.
Und wenn du eine Frage zu Versicherungen hast, dann ist sie in der Beratung die erste Wahl.
Weil sie so viel Fachkompetenz mitbringt? Sicher.
Entscheidend aber ist, dass sie authentisch ist, nicht drumherum redet, die Dinge einfach lässt, so dass du folgen kannst.
Meine Lebenserfahrung hat mich mal wieder in einem zentralen Punkt bestätigt:
Vertraue dem, dem es ernst ist mit dem ethischen Handeln, der es zu seinem wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kriterium erhebt.
27 Jahre übt Vera Tomaschewski nun schon ihren Beruf aus.
Sie kam vom Lehrerstudium, wurde über Umwege Erzieherin und fand schließlich ihre Bestimmung, nämlich Versicherungskauffrau zu sein.
Natürlich, vor über zwei Jahrzehnten hätte sie es wohl nicht für möglich gehalten, dass sie mal sagen würde, dass gerade dieser Beruf ihre eigentliche Berufung ist.
Sie hat es geschafft, weil sie mit Leidenschaft, mit viel Herz, und einem Rucksack an Fachwissen diesen steilen Berg hinaufgeklettert ist.
Das ist das Interview mit Vera Tomaschewski:
Frau Tomaschewski, was glauben Sie, was bringen Ihre Kunden mit Ihrer Person in Verbindung?
Ich behandle meine Kunden so, wie auch ich behandelt werden möchte. Das ist übrigens mein Credo, dem ich von Anfang an treu geblieben bin.
Deshalb bin ich davon überzeugt, ja ich weiß es, dass sie sich von mir gut betreut fühlen.
Warum ist es Ihnen so wichtig, dass Ihre Kunden von Anbeginn zu Ihnen Vertrauen fassen?
Nun, zum einen ist mir dieses ethische Anliegen einfach menschlich wichtig.
Zum anderen gibt es noch einen weiteren Aspekt: Nach der Wende kamen in die damals neuen Bundesländer sehr viele Versicherungsvertreter, überwiegend aus dem Westen, denen es nicht um eine nachhaltige Beratung ging.
Sie waren darauf aus, schnelle Abschlüsse zu generieren. Da haben sich viele Ostdeutsche über den Tisch gezogen gefühlt, wie man das so umgangssprachlich formuliert.
Diesem Trend wollte ich etwas entgegensetzen. Also habe ich stets versucht, versicherungstechnisch die optimalen Bedingungen für meine Kunden herauszuholen.
Hinzukam, dass ich stets darauf geachtet habe, dass wir eine gute Gesprächsatmosphäre haben. Der Kunde sollte sich wohlfühlen, sich nicht gedrückt fühlen, sondern wissen, dass ich ihn verstehe und daran anknüpfend die auf ihn maßgeschneiderten Konditionen und vertraglichen Bedingungen heraushole.
Was war der Grund, warum Sie in die Versicherungsbranche gegangen sind?
Ein Motiv war, dass ich thematisch bereits angerissen habe. Wir bekamen nach der Wende von Beratern Versicherungsverträge rhetorisch ‚aufs Auge gedrückt‘, die wir gar nicht wollten und die wir auch nicht brauchten.
Zunächst habe ich noch gedacht: ‚Oh, das hört sich ja toll an.‘ Aber später, im Nachgang, da merkten wir, wie schwierig es war, wieder aus den Verträgen herauszukommen.
Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr, so unwissend dazustehen, sondern ich machte mich kundig, wollte selbst wissen, was ich da abgeschlossen hatte.
Es kam noch ein weiteres Motiv hinzu. Mein Mann arbeitete in dieser Zeit bei der Wasserschutzpolizei.
Er wurde nach der Wende verbeamtet.
In seiner Behörde wurden Mitarbeiter gesucht, die nebenberuflich als Versicherungsverkäufer arbeiten wollten.
Mein Mann konnte so einer Tätigkeit nichts abgewinnen. Er war in dieser Zeit beruflich selbst viel unterwegs, nahm vor allem an zahlreichen eigenen Weiterbildungsmaßnahmen teil.
Ich hingegen interessierte mich für diese Tätigkeit, obwohl ich ja einen eigenen Beruf hatte und in meiner Tätigkeit voll ausgelastet war.
Dennoch, ich fragte nach, ob sich auch Frauen dafür bewerben konnten. Denn eigentlich war der Versicherungsmarkt nach der Wende mehr oder weniger eine Männerdomäne.
Also fragte ich denjenigen, der die sogenannten ‚Nebenberufler‘ betreute, ob ich mich ebenfalls bewerben konnte.
Die Idee für mich bestand zudem darin, die Weiterbildung zu nutzen, damit man selbst nicht so dumm dastand, wenn jemand kam, der einem etwas über Versicherungen erzählen wollte.
Und so begann meine Karriere in der Versicherungswirtschaft, neben meinem eigentlichen Beruf.
Wie ging es weiter?
Aus dem Rand von Berlin kam regelmäßig ein Mitarbeiter der Versicherung, der mit uns eine Produktschulung durchführte, in der Regel monatlich.
Das hat uns Teilnehmern allen sehr gut gefallen.
Es war ein kleiner Kreis, die Räume waren in einer Gaststätte und so saßen wir nach der Schulung zusammen und haben unsere Erfahrungen, unser Wissen ausgetauscht.
Nachdem die Schulungen zu Ende waren, wurde ich registriert und konnte so nebenberuflich meiner Tätigkeit nachgehen.
Haben Sie denn viele Verträge geschrieben?
Nein, das war anfangs sehr überschaubar. Meine Abschlüsse machte ich vor allem im Kollegenkreis, das waren für mich schon Erfolge, doch darüber hinaus ging es zunächst nicht, zumindest nicht in der Zeit von 1991 bis 1994.
1994 trat der damalige Chef der Versicherungsgesellschaft an mich heran und fragte, ob ich nicht hauptberuflich weitermachen wollte.
Die Fluktuation von Mitarbeitern war damals sehr groß. Ich entschied mich, ganz für die Versicherung zu arbeiten und gab meine frühere Tätigkeit auf.
Können Sie mal Ihren beruflichen Werdegang in den wichtigsten Abschnitten schildern?
Ich wurde 1968 eingeschult und habe die Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule besucht.
Anschließend bin ich in die Erweiterte Oberschule gewechselt, dem heutigen Gymnasium.
Mein Abitur habe ich 1980 gemacht. Ich wollte immer Lehrer werden, schon von der ersten Klasse an.
Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch, und ich habe alles darangesetzt, diesen Beruf auch zu erlernen.
Ich ging 1980 folgerichtig an die Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald und habe dort in den Fächern Geografie und Mathematik studiert.
Geografie war mein Hauptfach, Mathematik das Nebenfach. Insgesamt hat mir das Studium einen riesigen Spaß gemacht.
Und trotzdem musste ich im dritten Studienjahr aufhören.
Wie kam es dazu?
Ich will es mal so ausdrücken: Wir hatten einen Professor, der etwas kompliziert war.
Der hat mir mein Studium regelgerecht verleidet. Im Ergebnis schaffte ich eine Prüfung in Mathematik nach dem zweiten Jahr nicht, obwohl ich mich sehr intensiv vorbereitet hatte.
Dieser Professor musste zwar ein Jahr nach mir ebenfalls die Universität verlassen, doch das half mir dann auch nicht mehr weiter.
Obwohl ich also bereits nachfolgende Prüfungen bestanden hatte, musste ich nach dem 5. Semester gehen. Das war bitter für mich, denn ein Lebenstraum von mir zerplatzte in dem Moment.
Gab es denn keine anderen Möglichkeiten als die Kombination von Geografie und Mathematik?
Geografie wollte ich unbedingt studieren. Es gab noch Geografie und Sport.
Aber im Sport hätten die Leistungen nicht ausgereicht. Es blieb nur die Alternative von Geografie und Mathematik.
Und das Kuriose an der Geschichte war, dass wir ja bereits vor Klassen gestanden und unterrichtet haben. Aber die Prüfungen in Mathe haben mir das Genick gebrochen.
Was haben Sie dann gemacht?
Ich musste andere Wege gehen, daran führte nichts vorbei. Hinzukam, dass ich in der Zwischenzeit schwanger geworden war. Ich hatte deshalb auch schon ein Zimmer für ‚Mutter und Kind‘.
Haben Sie Ihren Mann in Greifswald kennengelernt?
Nein, ich bin ja am Wochenende meistens nach Hause gefahren. Wir hatten eine sehr gute Zugverbindung von Bad Freienwalde nach Greifswald.
Mein Papa hat mich oft nach Eberswalde gefahren. Von da aus ging es direkt bis nach Greifswald durch.
Wann wurde Ihr Sohn geboren?
Im März 1983.
Also war es ja auch irgendwie schön, dass Sie ab 1983 wieder Zuhause waren, oder?
Ja, natürlich, aber ich musste überlegen, wie es weiterging.
Mein damaliger Direktor von der Erweiterten Oberschule wollte mir helfen. Er war inzwischen im Bereich Bildung in der Kreisverwaltung tätig.
Und so kamen wir auf die Idee, dass ich als Lehrerin in der Unterstufe in Frankfurt/Oder beginne, weil ich unbedingt etwas mit Kindern machen wollte.
Hat das geklappt?
Nein. Da waren genügend Bewerber, die zu Ende studiert hatten und so kam ich als Studienabbrecherin für eine Anstellung als Unterstufenlehrerin nicht infrage.
Also war wieder das große Fragezeichen, wie es weiterging.
Der ehemalige Direktor vermittelte mich dann in eine Kita in Bad Freienwalde.
Ich habe dort als Hilfskraft angefangen, denn das, was ich vorher studiert hatte, wurde nicht anerkannt.
Im ersten Jahr habe ich neben meiner Tätigkeit eine Ausbildung zur Erziehungshelferin gemacht.
Daran schloss sich eine Ausbildung zur Kindergärtnerin an, anderthalb Jahre im Fernstudium.
Insgesamt war ich dort elf Jahre, von 1983 bis 1994, eine wirklich schöne Zeit, auf die ich gern zurückblicke.
Das heißt, in diese Zeit fiel auch der Beginn Ihrer nebenberuflichen Tätigkeit in der Versicherung?
Ja, von 1991 bis 1994 habe ich noch hauptberuflich in der Kita als Erzieherin gearbeitet und nebenher mit der Tätigkeit in der Versicherung begonnen.
Was hat sie bewogen, den Beruf der Kita-Erzieherin an den Nagel zu hängen?
Ganz offen gesagt, ich hatte Angst, dass ich nach 30 Jahren in ein mentales Loch falle, irgendwie eine Macke bekommen würde.
Dass Sie mich nicht falsch verstehen: Ich habe meinen Beruf geliebt. Aber die Tätigkeit der Kita-Erzieherin hinterlässt Spuren.
Es sind ja nicht nur die Kinder, die gut betreut werden sollen. Nein, es sind ebenso die Eltern, deren Vorstellungen man gleichermaßen entsprechen will.
Liegt das nicht in der Natur der Sache, dass sich Eltern sorgen?
Schon, doch wenn es überhandnimmt und in Einzelfällen der Bezug zur Realität verlorengeht, dann schaden die Eltern nicht nur den eigenen Kindern, sondern sie beeinträchtigen auch das Erziehungspotenzial, das es in so einer Einrichtung gibt.
Das zerrt dann schon mal an den eigenen Nerven.
Ich habe in jener Zeit viel autogenes Training betrieben, zusammen mit anderen Kollegen.
Und trotzdem, manchmal spürte ich, dass ich abends nicht mehr die Kraft hatte, meinen eigenen Kindern die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, die die anderen Kinder am Tag von mir bekommen haben.
Natürlich war ich die liebe Mama, aber mitunter habe ich auch geschimpft, weil ich ausgelaugt war, davon, dass ich tagsüber die Kinder anderer Eltern zu betreuen hatte.
Es war ein Traumberuf, aber ich begann darüber nachzudenken, wie es in den kommenden Jahren werden würde, ob ich es schaffen könnte – mental und physisch.
Aus vielen Mosaiksteinen ist das Bild bei mir entstanden und daraus wieder die Erkenntnis, dass ich nicht über Jahrzehnte als Erzieherin arbeiten wollte.
Sie sprechen von Ihren Kindern, gibt es noch mehr als Ihren Sohn?
Ja, 1985 wurde meine Tochter geboren.
In welche Versicherung sind Sie 1991 gegangen?
Das war die Deutsche Beamtenversicherung DBV. Die DBV ist dann in der AXA aufgegangen.
In den neunziger Jahren ging die DBV zunächst in der Winterthur auf, sodass wir ‚DBV-Winterthur‘ hießen. Danach hat die AXA die Winterthur übernommen.
Faktisch übernahm das eine weltweit agierende Unternehmen das andere.
Ich selbst bin aber all die Jahre im gleichen Unternehmen geblieben.
Waren Sie Anbeginn an in der Selbstständigkeit?
Nein, ich war anfangs angestellt und bin erst anderthalb Jahre später in die Selbstständigkeit gewechselt.
Ich habe jedoch schon immer in der Ausschließlichkeit für das Unternehmen AXA gearbeitet. Das heißt, ich arbeite auf selbstständiger Basis, aber nur für eine Versicherungsgesellschaft und deren dort integrierte Partner.
Was haben Sie für eine Ausbildung in der Versicherung durchlaufen?
Unsere Ausbildung lief über das Bildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft.
Wir sind dazu alle zwei Wochen in die Pfalz gefahren, in das wunderschöne Bad Dürkheim.
Am 09. Mai 1996 wurde mir dann die Abschlussurkunde überreicht und von da an durfte ich mich Versicherungsfachfrau nennen.
Wie war das bei Ihnen, haben Sie sogenannte Bestandskunden bekommen, damit der Start für Sie ein wenig leichter war?
Das war damals nicht üblich, leider.
Ich hatte einige wenige Kunden in meinem Bestand, die noch aus Verträgen in dem alten Kollektiv entstanden waren. Das waren vor allem Kollegen von meinem Mann – aus der Wasserschutzpolizei.
Aber wie sind Sie denn an Kunden gekommen, Sie mussten ja von irgendetwas leben?
Ja, natürlich. Ich kann nur sagen, dass ich nie ‚Klinken geputzt‘ habe. Das habe ich gehasst.
Was haben Sie stattdessen getan?
Ich habe versucht, persönliche Kontakte zu knüpfen, durch Bekannte das Feld zu erweitern.
Des Weiteren habe ich Flyer verteilt, persönlich und in Zeitungen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich die Flyer in einem Nachbarort verteilt habe, bei gefühlten 60 Grad Celsius.
Kurzum, ich habe selber die Trommel gerührt. Die Leute sollten wissen, dass ich da bin für sie, wenn es um Versicherungsfragen ging.
Prinzipiell habe ich niemals aus der eigenen Verwandtschaft jemanden angesprochen.
Denn irgendwann hat sich das erledigt.
Erst viel später, nach zehn Jahren kamen auch mal Kontakte aus dem eigenen Verwandtenkreis zustande, auf Initiative meiner Verwandten.
Nach und nach kamen auch Empfehlungen aus dem allmählich anwachsenden Kundenstamm.
Können Sie von den Erträgen, die Sie erwirtschaften, leben?
Ja, inzwischen kann ich das.
Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang eine Sache: Für mich galt stets, dass der Beruf und die damit eng verknüpfte Berufung zusammengehören.
Das war in meiner Zeit als Erzieherin in der Kita so und jetzt genauso.
Im September werden es bereits 27 Jahre, wo ich den Beruf des Versicherungsberaters ausübe.
Sind Sie ein selbstbewusster Mensch?
Es ist schlecht, sich selbst einzuschätzen, aber ich denke schon, dass ich selbstbewusst bin.
Das Selbstbewusstsein wächst ja mit den Lebensjahren.
Was bedeutet es für Sie, individuelle Kundenbeziehungen zu entwickeln?
Individuelle, maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln, den Kunden so zu beraten, dass er wirklich das bekommt, was er braucht und auf der anderen Seite auch wegzulassen, was er nicht braucht, das verstehe ich unter individuellen, persönlichen Kundenbeziehungen.
Das hat sich bei mir über die Jahre entwickelt.
Klar, ich wollte nicht Versicherungsverträge verkaufen, die eigentlich keiner braucht, so wie es oft nach der Wende geschehen ist.
Das heißt deshalb, sich für den Menschen interessieren, seine Bedürfnisse kennen und von da aus die Lösung für ihn zuzuschneiden.
Das hieß auch, so manchen Kampf im Kundensinne mit der Zentrale zu führen, sich zu engagieren, damit es am Ende für alle passt.
Und wenn dann ein Kunde zu einem Feiertag einen Gruß schickt, zum Beispiel über WhatsApp, ja dann weiß ich, dass ich nicht alles falsch gemacht habe.
Über die Jahre haben sich so Freundschaften entwickelt, die bis heute halten.
Wie gehen Sie mit negativen Meinungen von Kunden um?
Ich gehe den Dingen stets auf den Grund. Ist was dran an einer Kritik, dann setze ich mich dafür ein, dass die Probleme gelöst werden, zur Zufriedenheit der Kunden.
Bei pauschalen geringschätzenden Bemerkungen nehme ich das alles mit Humor, versuche drüberzustehen. Wichtig ist für mich: Der Ruf der Versicherung steht und fällt mit demjenigen, der sie vertritt. Ich bin jemand, der sich kümmert, der so lange arbeitet, bis der Kunde zufrieden ist.
Das gibt mir die nötige Selbstsicherheit und das ist es auch, was die Kunden zum Schluss mit ihrer Wertschätzung mir gegenüber danken.
Wie sind Sie in der Anfangszeit finanziell klargekommen?
Anfangs war es wirklich nicht leicht, vor allem, weil nebenher noch meine Ausbildung lief.
Dadurch hinkte ich hinterher, was die Zielvorgaben für mich anbetraf. Ich war im Minus. Die Versicherungsgesellschaft bot mir in dieser Situation an, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit zu wechseln, ohne dass ich Garantiebezüge erhielt.
Was haben Sie in der Zeit bekommen?
Nur den Gegenwert für das, was ich an Verträgen produziert habe.
Das diszipliniert ja, also strengst du dich mehr an.
Ich war zum Beispiel viel mehr im Außendienst, als das heute der Fall ist.
Auf der anderen Seite: Wo Schatten ist, da gibt es irgendwann auch wieder Licht.
Ich hatte zwar schwere Zeiten, doch dadurch, dass ich keine Garantiebezüge hatte, war ich nicht abhängig und nicht unter Druck.
Wie viel Spaß macht Ihnen Ihre Arbeit?
Sehr viel Spaß.
Bad Freienwalde ist eine Kleinstadt, und ich wollte nicht unbedingt die Straße wechseln, wenn mir ein Kunde entgegenkam. Da wollte ich mich schon von jenen Vertretern unterscheiden, die nach der Wende vor allem auf schnelle Abschlüsse aus waren.
Das ganze Drumherum, das macht mir wirklich einen riesigen Spaß.
Es ist ein Beruf, in dem man anderen Menschen zuhören muss.
Viele Kunden kommen und berichten von ihren Alltagssorgen.
Du bist dann schon fast ein Psychologe, gibst diesen oder jenen Ratschlag.
Und du erzählst selbst von dir, davon, was dich bewegt. So wächst man zusammen, fasst Vertrauen zueinander, weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann.
Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Ich bin zufrieden. Es gibt immer Sachen, wo man sagt, dass es noch anders laufen könnte.
Aber insgesamt: Ich bin gesund, wir wohnen auf dem Grundstück meiner Mutti.
Mein Papa ist leider schon verstorben.
Ich mach‘ es mir schön, soweit ich es mir schön machen kann.
Dazu zählt beispielsweise die Gartengestaltung, das ist für mich ein wirklich toller Ausgleich zu meiner Arbeit.
Warum verwenden Sie eher die Vokabel ‚zufrieden‘ als das Wort ‚glücklich‘?
Glücklich sein, dazu gehört für mich noch eine Nuance mehr.
Es gibt ja stets Dinge, die nicht so gut laufen.
Was meinen Sie?
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Da musste zum Beispiel eine Kurzzeitpflege organisiert werden, ein Heimplatz für meine Tante – das alles sind Dinge, die einen erschöpfen, die Kraft rauben.
Insgesamt jedoch bin ich ein sehr positiver Mensch.
Woran haben Sie besonders Freude?
Ach, da gibt es so einiges. Ich bin gern am Meer, inhaliere die Seeluft, schaue zu, wie die Wellen am Strand aufschlagen und sich wieder zurückziehen – das bringt mich auf andere Gedanken, lässt mich Energie tanken.
Oder eben die Gartenarbeit, bei der ich alles um mich herum vergessen kann und mich einfach an den Blumen freue, daran, wie ich den Garten gestaltet habe.
Würden Sie alles wieder so machen, wenn Sie erneut vor der Wahl stünden?
Ja, ich denke schon. Die Arbeit mit den Kunden gibt mir viel an Positivem zurück. Hinzukommt, dass ich so Manches hätte ich gar nicht bewerkstelligen können, wenn ich in einer Festanstellung gewesen wäre.
Ich denke da nur daran, wie ich meine Tochter als Kind zur Orchesterprobe gefahren habe.
Klar, ist man festangestellt, so bekommt man ein dreizehntes Gehalt, hat andere Sicherheiten.
Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden mit meinem Leben. Der Beruf ist zu einer wirklichen Berufung für mich geworden, und das macht mich auch ein klein wenig stolz.
Frau Tomaschewski, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Zum Firmenporträt: https://uwemuellererzaehlt.de/2021/07/14/firmenportraet-2021-07-14/


Mehr lesen: 2021: https://uwemuellererzaehlt.de/ueber-menschen-erzaehlen/menschen-im-alltag-2021/ 2020:https://uwemuellererzaehlt.de/ueber-menschen-erzaehlen/menschen-im-alltag-2020/ 2019: https://uwemuellererzaehlt.de/ueber-menschen-erzaehlen/menschen-im-alltag-2019/