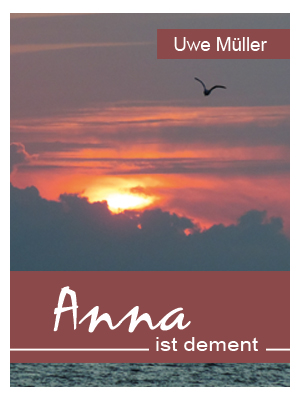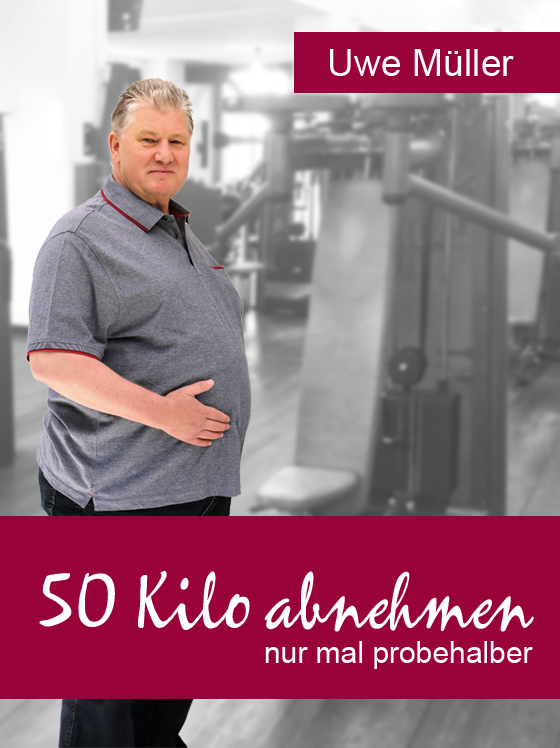ENDLICH, DIE SCHATZSUCHE BEGINNT
Die Kinder und Erwachsenen treffen sich auf dem Parkplatz in der Schorfheide.
Von da aus geht es direkt in den Wald, zwischen die Kiefern, vereinzelte Birken und Buchen.
Der Waldboden ist übersät mit Wurzeln, Kienäpfeln, Laub aus dem vergangenen Herbst.
„Passt auf, dass ihr nicht stolpert“, sagt der Fahrer gleich zu Beginn.
Alle sind aufgeregt, auch die Erwachsenen. Sie plappern durcheinander.
„Bitte mal alle herhören“, ruft da der Fahrer.
„Die Teilnehmer an der Schatzsuche teilen sich in zwei Gruppen auf:
Zur ersten Gruppe gehören Jeepy, ich als sein Fahrer und die Kinder Ameli, Jana, Denny, Darian, Otto und Dietmar, der Vater von Ameli.
In die zweite Gruppe gehören Fiatine, der Verkäufer und die Kinder Lina, Lou, Dimitri, Peter und eine Mutter, Margarete. Ihr müsst jetzt direkt durch den Wald laufen.“
Und weiter erläutert der Verkäufer: „Fiatine, du stehst an der ersten Station und stellst deine beiden Fragen, die du dir ausgedacht hast. Der Gewinner bekommt einen kleinen Preis. In Ordnung?“
„Ja“, rufen da alle.
„Dann geht es jetzt los, viel Spaß beim Suchen nach der Schatzkiste. Schaut auf die Karten, die beide Gruppen haben und orientiert euch an den Pfeilen und Bändern an den Bäumen, an denen ihr vorbeikommt“, erläutert noch der Fahrer.
Die beiden Gruppen sind losgelaufen. Jeppy ist zu seiner Station gefahren und Fiatine auch. Es sind die wichtigsten Abschnitte, die jeweils eine Gruppe passieren muss.
An der ersten Station steht Fiatine und wartet aufgeregt auf die Gruppe. Plötzlich hört sie Stimmen und da kommen die Kinder und Dietmar auch schon zwischen den Bäumen hervor.
„War es leicht, mich zu finden?“, fragt Fiatine.
„Naja, ich weiß ja nicht, wer die Karte gemalt hat, aber derjenige hat wohl nicht viel mit dem Zeichnen und der Geographie am Hut“, sagt da Dietmar.
„Das war der Fahrer von Jeepy“, antwortet Fiatine.
„Na der kann froh sein, dass er ein Navigationsgerät im Auto hat. Müsste der nach seiner Karte fahren, würde Jeepy nie am Ziel ankommen“, ergänzt Dietmar.
Der Verkäufer stand ruhig und schmunzelte vor sich hin.
‚Der Verkäufer hätte mal was dagegen sagen können‘, denkt Fiatine. Sie findet, dass Dietmar nur meckert. Beim Kartenzeichnen war der jedenfalls nicht dabei.
Aber laut sagt sie: „Kinder, lieber Dietmar, ich stelle euch jetzt zwei Fragen. Wenn ihr sie richtig beantwortet, bekommt ihr schöne Preise.“
Fiatine schaute in die Runde, in die erwartungsvollen Gesichter.
„Also, es geht los: Welcher Baum kommt am häufigsten in Brandenburg vor?
A)Die Birke oder B)die Eiche oder C) die Kiefer?“
Die Finger der Kinder schnellen in die Höhe.
„Das ist die Kiefer“, sagt Ameli, die als erste den Arm gehoben hat.
„Och, das war ja ‚piepeleicht‘“, sagt da Denny aus der Gruppe.
„Richtig. Achtung, jetzt kommt die zweite Frage: Welche ist die zweithäufigste Baumart in Brandenburg?
A) Die Birke oder B) die Buche oder C) Die Eiche?“, fragt Fiatine.
„Das ist wohl eine Frage für mich“, sagt Dietmar.
„Und welche Antwort ist deiner Meinung nach die richtige?“, hakt Fiatine nach.
„Ich denke A, die Birke.“
„Falsch, falsch“, rufen da die Kinder.
„Denny, was meinst du?“, fragt Fiatine.
„Na die Eiche ist richtig. Das weiß ich von meinem Großvater, der ist Jäger“, sagt Denny stolz.
„Prima, das ist richtig“, sagt Fiatine und überreicht ihm ein Päckchen mit Malstiften.
Und an Dietmar gewandt: „Du würdest wohl keine Jägerprüfung bestehen, mit deinen Kenntnissen. Das hätte der Fahrer von Jeepy aber gewusst.“ Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Dietmar schwieg betreten.
„Für euch noch zur Erläuterung, Dietmar und liebe Kinder: Die Eiche kommt auf einem Waldgebiet von insgesamt 70.000 Hektar vor, gefolgt von der Buche auf ca. 34.600 Hektar.“
Sie hatte sich gut auf das Rätsel vorbereitet und einiges über den Baumbestand in Brandenburg und insbesondere in der Schorfheide gelesen.
Während sich die Gruppe wieder auf den Weg macht, sind auf der anderen Station die Kinder um den Fahrer und Margarete angekommen.
Jeppy erwartete sie schon.
„So, passt gut“, sagt Jeepy, holt tief Luft und stellt seine Fragen:
„Wie viel Waldeigentümer gibt es in Brandenburg?
A) 100.000 oder B) 1000 oder C) 100?“
Lina hebt die Hand.
„Lina, was meinst du?“, fragt Jeepy sie.
„Vielleicht 100?“
„Nein, das ist falsch.“
„1000″, sagt da Dimitri.
„Nein, es sind 100.000 Waldeigentümer“, klärt Jeepy die Gruppe auf.
„Och, so viele“, staunen die Kinder.
„Ja, das hatte ich vorher auch nicht gewußt, wenn der Fahrer es mir nicht gesagt hätte und der hat es vorher gegoogelt“, erklärt Jeepy.
Die Kinder nicken und finden es gut, dass Jeepy so ehrlich ist.
„Und nun zu der zweiten Frage: Was glaubt ihr, wie viel Prozent der gesamten Waldfläche den privaten Waldeigentümern gehört:
- A) 61% oder B) 20 % oder C) 10 %?“
„Wahrscheinlich gehört den Waldeigentümern der größte Anteil, also A“, sagt Margarete.
„Richtig“, stimmt Jeepy zu.
„61% gehören privaten Eigentümern, 26% dem Land Brandenburg, 7 % kommunalen Einrichtungen und 6 % dem Bund“, liest Jeepy vom Zettel ab.
„Und hier sind eure Preise“, ruft Jeepy.
Es gibt ein kleines Planschbecken, einen Wasserball und kleine Früchtekörbe für unterwegs.
Die Kinder sind begeistert und ziehen weiter.
Fast gleichzeitig kommen die beiden Gruppen an der Stelle an, an der die Schatzkiste vergraben sein muss.
„Schaut mal in die Nähe der beiden Holzbänke“, raunt jetzt Jeepy den Kindern zu.
Die suchen fleißig weiter.
Da ruft Darian: „Hier ist eine weiche Stelle. So als ob jemand ein Loch ausgehoben hat und ein Deckel darauf liegt.“
Die Kinder und die Erwachsenen kommen schnell zu der Stelle.
Der Fahrer und der Verkäufer schauen sich an und schmunzeln.
„Na dann macht doch einfach mal den Sand weg“, sagt der Verkäufer.
Eifrig beginnen die Kinder mit den Händen den Sand wegzuwischen. Sie nehmen die Holzplatte weg und entdecken die Kiste.
„Hier ist sie!“, rufen sie aufgeregt.
„Wartet, wir heben sie aus dem Loch“, sagt der Fahrer.
Und da stand sie nun, die Kiste.
„Wir haben ein letztes Rätsel. Wir verbinden einem Kind die Augen und es muss erraten, was es gerade isst. Wenn es richtig ist, darf diejenige oder derjenige die Kiste öffnen. Wer möchte das?“
„Ich, ich auch“, rufen da alle Kinder.
„Gut, wer hat heute noch nicht mitgeraten?“, fragt der Fahrer.
„Ich“, sagt Otto. „Ich habe auch noch nichts erraten“, ruft Jana.
„Gut, Jana, dann binden wir die Augen zu. Und du musst erraten, welches Obst du gerade schmeckst.“
„Gut“, sagt Jana.
Der Fahrer nimmt eine Kiwi aus dem Korb, schält sie schnell ab und gibt sie Jana.
„Das ist eine Kiwi“, ruft Jana sofort.
„Donnerwetter, das ging ja schnell“, sagt da der Fahrer. Er hätte nicht gedacht, dass Jana so schnell das Rätsel löst.
„So, Jana, dann mach den Deckel auf.“
„Jana hebt den Deckel an und zum Vorschein kommen die Goldstücke. Sie glitzern in der Sonne.“
„Oh, das ist ja wie ein richtiger Schatz“, rufen die Kinder.
„Ja, und in Wirklichkeit ist es Schokolade, die ihr essen könnt.“
„Au ja“, freuen sich die Kinder.
„Aber bitte nicht alles auf einmal“, sagt der Fahrer, während er und der Verkäufer die Goldtaler verteilen.
„Zum Abschluss lade ich euch alle zum Grillen in den Wildpark ein“, sagt noch der Fahrer.
Alle sind begeistert und streben dem Eingang zum Wildpark zu.
„War das nun ein richtiges Abenteuer?“, fragt der Fahrer den Verkäufer.
„Naja, vielleicht kein richtiges Abenteuer, aber ein Tag mit viel Spaß und ein bisschen hinzugelernt haben wir auch alle.“
Der Fahrer nickt zufrieden.