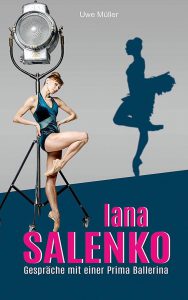MAL SCHNELL ERZÄHLT
TEASER:
Peter verhielt sich beim Einkauf im Baumarkt ungeschickt und wurde von Klara barsch vor den Leuten gerüffelt.
Es begann bereits dunkel zu werden, als der Regionalzug aus Berlin am Bahnsteig einlief. Er hielt kaum, da drängten die Menschen aus den Türen heraus und hasteten im Eiltempo in Richtung Parkplatz, dorthin, wo Peter bereits mit seinem Auto stand und auf Klara wartete.
Peter schaute fasziniert zu, wie sich die Leute verhielten.
Ein Mann fiel Peter an diesem Tag besonders auf. Er nannte ihn den Mann mit den vier Buchstaben, weil er stets die gleiche Jacke trug, und weil auf der Rückseite vier Buchstaben prangten, der Name seiner Firma, in die er jeden Tag fuhr.
Morgens, da sahen Klara und Peter ihn schon von weitem, weil die Buchstaben auf dem Rücken im Dunkeln weiß leuchteten. Der Mann ging nicht, er wankte von einem Bein auf das andere, langsam, so als müsse er sich dahinschleppen.
Abends hingegen, da hatte er einen recht flotten Schritt angenommen und beeilte sich, nach Hause zu kommen. Und das beobachtete Peter bei den meisten Menschen, die er früh sah und abends wieder. Es waren die gleichen Menschen, aber mit einem unterschiedlichen Schritttempo, je nach Tageszeit.
Klara war inzwischen an seinem Auto angekommen. Sie öffnete die Tür, stieg ein und fragte gleich:
„Wollen wir noch in den Baumarkt?“
„Können wir machen“, brummte Peter ziemlich lustlos.
Aber was sollte er tun, denn in der Küche war eine Leuchtstoffröhre kaputt. Sie flackerte zwar noch, doch es machte ihn wahnsinnig, wenn er morgens dort stand und die Kaffeemaschine anstellte.
Klara hatte Peter diese Aufgabe übertragen, weil er seine Wasserflasche für das Fitness-Studio fertigmachte.
„Da kannst du doch gleich den Kaffee aufsetzen“, schlug Klara vor.
Peter übernahm immer mehr Aufgaben im Haus, obwohl er das gar nicht wollte. Aber er war nun mal derjenige, der seinen Schreibtisch zuhause stehen hatte.
„Irgendwann kommt sie noch und sagt, dass ich die Waschmaschine anstellen soll“, dachte Peter. Aber er schob diesen Gedanken gleich beiseite.
Jetzt ging es also erst einmal in den Baumarkt in Richtung Bernau.
Als sie auf den Markt zusteuerten und einen Stellplatz suchten, verlor Klara die Geduld: „Immer schön in die entlegenste Ecke fahren, die am weitesten weg ist vom Baumarkt“, motzte sie.
Peter antwortete nicht. Was verstand Klara schon davon. Er fuhr zwar einen kleinen Jeep, aber er war noch so eingestellt, als müsste er den großen Mercedes-Geländewagen in eine Parklücke steuern.
Schließlich hielt er an, sie stiegen aus dem Jeep aus und gingen zum Eingang des Marktes.
„Schau mal hier“, sagte Peter und öffnete seine Jacke.
Darunter kamen Hosenträger zum Vorschein, die an einer Trainingshose befestigt waren. Er kam sich vor, wie Krause, der Schauspieler, der stets die Hosenträger offen über dem Hemd trug.
„Mach bloß wieder die Jacke zu“, sagte Klara und schaute sich um, ob auch niemand zu ihnen hinsah.
Peter war das egal. Im Gegenteil, er fand es klasse, dass er vom Schreibtisch aufstehen konnte, in die Schuhe schlüpfte, deren Schnürsenkel er auch nur noch selten aufmachte, die Jacke überschmiss, den Autoschlüssel schnappte und schon abfahrbereit war.
Schließlich wollte er ja nicht ins Theater. Aber Klara sah es lieber, dass er wenigstens seine Jeans anzog.
Doch Peter blieb da eisern und trug seine Trainingshosen.
Peter ging auf die Kasse im Eingangsbereich zu, wo oben drüber das Schild ‚Information‘ aufgehängt war.
„Sagen Sie, können Sie mir kurz erklären, wo wir hier diese Leuchtstoffröhren finden“, fragte er die Kassiererin, die ihn unfreundlich musterte und besonders auf seine Wollmütze schaute, die er tief über den Kopf bis fast ins Gesicht gezogen hatte.
Vielleicht dachte sie ja, dass Peter die Mütze im nächsten Augenblick ganz über das Gesicht zog und nach dem Kleingeld in der Kasse fragte.
„Gang 22“, sagte sie kurz angebunden.
„Oh, wunderbar, vielen Dank“, flötete Peter fröhlich und zeigte Klara mit dem Arm den Weg.
„Gang 22, da ist er“, sagte er und schritt die Regale ab.
Aber Peter sah nicht, wo die Lampen waren.
Da war Klara besser.
„Hier, schau mal, da sind sie!“.
Klara hatte schon eine Leuchtstoffröhre in der Hand.
„900 mm, 30 Watt, das passt“, sagte sie und drückte sie Peter in die Hand.
Der nahm sie und wandte sich in Richtung Kasse.
„Sollen wir die alte entsorgen?“, fragte die Kassiererin?
„Oh, das ist aber nett“, meinte Peter und gab ihr die alte Leuchte in die Hand.
Klara war noch beim Bezahlen, während Peter übermütig die verpackte Leuchtstoffröhre hin- und herschwenkte.
Plötzlich gab es einen lauten Knall. Peter schaute sich um, weil er nicht mitbekam, woher der Lärm kam.
Doch dann sah er auf dem Fußboden die neue Röhre liegen, zerschellt in winzige Teile.
Peter schaute verdattert, die Augen der Kassiererin richteten sich auf ihn, die von Klara auch und einige Kunden schauten ebenfalls neugierig herüber.
Offenbar hatte sich eine Seite der Verpackung gelöst und die Leuchtstoffröhre war herausgerutscht.
„Was hast du denn nun schon wieder gemacht?“, fragte Klara ihren Mann, so als wäre der ein kleines Kind, das wieder etwas ganz Schlimmes angerichtet hatte.
Ihr Blick sagte: „Oh, es tut mir leid, das ist zwar mein Mann, aber er ist in Wirklichkeit ein großer Trottel.“
Peter war es peinlich, dass er nun diesen Lärm verursacht hatte, doch noch mehr ärgerte ihn, dass Klara ihn nun erst recht wie einen ungeschickten, zu nichts zu gebrauchenden, lediglich mitgekommenen Ehepartner aussehen ließ.
„Gehen Sie schnell zum Regal und holen sich eine neue Röhre, wir kümmern uns hier“, sagte eine Angestellte versöhnlich.
Peter nickte, lief zum Regal und holte die neue Leuchtstoffröhre.
„Sie müssen nicht noch einmal bezahlen“, sagte die Kassiererin.
Peter und Klara bedankten sich und gingen stumm zum Ausgang.
Sie stiegen wortlos ins Auto und schwiegen eine Weile auf der Fahrt nach Hause.
„Warum hast du mich wie einen Trottel behandelt?“, fragte Peter schließlich.
„Ach, das war doch nicht so gemeint“, lachte Klara.
„Darüber kann ich nicht lachen!“, empörte sich Peter und schwieg, bis sie am Carport angekommen waren.