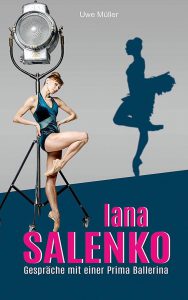Pflege und Betreuung von kranken und hilfsbedürftigen Menschen haben in der aktuellen Zeit einen Stellenwert erlangt, wie sonst wohl kaum etwas an Relevantem in unserer Gesellschaft.
Dabei überschlagen sich manche in der Politik darin, die Anstrengungen der Pflegekräfte zu würdigen, andere wiederum finden nach wie vor, dass viel zu wenig passiert. Beides hat sicherlich seine Berechtigung, wenn man in die Tiefe der Argumentationen einsteigt.
„Euer Klatschen könnt ihr euch sonst wohin stecken“, so äußerte sich kürzlich eine Berliner Krankenschwester frustriert und verzweifelt über den andauernden Personalmangel an Pflegekräften und die nicht ausreichende Wertschätzung für diejenigen, die im medizinischen oder Pflegebereich arbeiten.
(Vgl. „Wut-Rede in Krisen-Zeiten. Die Berliner Krankenschwester beklagt ein System, das auf Profit setzt, Personalmangel – und Klatschen als Geste der Anerkennung. Berliner Zeitung, Nummer 169, Donnerstag, 23. Juli 2020, Seite 11).
Ich begleite mit meinen Gesprächen, Interviews und Berichten seit einigen Jahren die Freie Alten- und Krankenpflege e.V. in Essen, und ich weiß, dass sie genauso viel Grund hätten, Defizite und Mängel anzukreiden, die jeder kennt, der in der Pflege zuhause ist.
Doch die FAK e.V. zeichnet gerade in dieser Zeit eines aus: Sie klagen nicht, nein, sie handeln. So öffnet Anfang September 2020 das neue Wohngemeinschaftshaus „Op dem Berge“ in Essen-Bochold, in der es auch eine Tagespflegeeinrichtung geben wird. Im November folgt dann die neue Demenz-Wohngemeinschaft „Mittendrin“ in Essen-Frohnhausen.
Und schließlich bezieht die FAK das Wohngemeinschaftshaus „Emscherblick“ in Essen- Altenessen, in der es ebenfalls eine Tagespflegeeinrichtung, im FAK- Jargon „Emscherglück“ genannt, geben wird.
Das sind anspruchsvolle Projekte in dieser Zeit, zumal ja wiederum neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die einzelnen Einrichtungen gewonnen werden müssen.
Michael Jakubiak, einer der Geschäftsführer der Freien Alten – und Krankenpflege, zeigt sich gewohnt optimistisch: „Wir sind positiv überrascht von den zahlreichen Bewerbungen für unsere Vorhaben“, sagt er im Gespräch.
Mehr erfahren unter: http://www.fak.de
DAS TEAM – OPTIMISTISCH BLEIBEN, DINGE NACH VORN LÖSEN UND AUCH NOCH SPASS HABEN
Wer das Team und die Geschäftsführung kennt, der weiß, dass nichts im Selbstlauf passiert. Es gibt handfeste Gründe, warum die FAK e.V. solch einen Sog auf Bewerberinnen und Bewerber ausübt.
Da ist zum einen die Tatsache, dass die Gründer der Freien Alten- und Krankenpflege e.V., wie zum Beispiel Michael Jakubiak, seit nunmehr fast vier Jahrzehnten immer an einer Idee drangeblieben sind: Nämlich, dass alte und kranke Menschen selbstbestimmt und autonom in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben können, obwohl sie auf Pflege und Betreuung angewiesen sind.
Und wenn das nicht mehr geht, in einer der Einrichtungen und Häuser der FAK e.V. leben und wohnen zu können, in der die Bewohner ihre Einsamkeit überwinden lernen, um neben der fachlichen Pflege und Betreuung eines zu finden: eine familienähnliche Atmosphäre.
Dieses ethische Verständnis ist nicht aus äußeren Worthülsen gebaut. Nein, es ist tief in der DNA des gesamten Teams der FAK e.V. verankert.
Das ‚schreit‘ sich natürlich nicht heraus, es schweigt sich eher in Essen und Umgebung herum. In der aktuellen Stellenanzeige der FAK e.V. steht: Wir brauchen keine Roboter. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Sie! Wer das Team kennt, der weiß, dass jedes Wort so gemeint ist. Die Wertschätzung beginnt dort, wo Menschen mit ihren Fähigkeiten und Stärken gebraucht werden und sie setzt sich darin fort, dass sich alle in der FAK e.V. wohlfühlen sollen – die Bewohner in den Wohngemeinschaften und die Pflegekräfte.
Nur so kann ein fundierter Rahmen geschaffen werden, wo das Wohnen, das Leben und das Pflegen und Betreuen Spaß machen, ja, sich das alles gegenseitig bedingt. Könnte ich noch einmal von vorn beginnen, so würde ich in der Pflege anfangen, und würde ich in Essen und Umgebung wohnen, ich wüsste, mit wem ich zusammenarbeiten wollte.