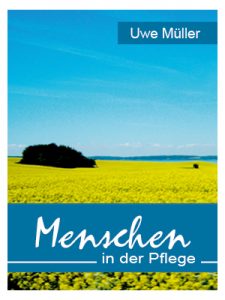Die Freie Alten- und Krankenpflege e.V. verfügt über eine 30-jährige Erfahrung in der Pflege und Betreuung. Michael Jakubiak ist ihr Gründungsvater und heute einer der beiden Geschäftsführer. Im Interview berichtet er über seine Erfahrungen, die ethischen Wurzeln des Vereins und wie er heute die neuen Herausforderungen in der Pflege sieht.
Herr Jakubiak, wie verlief Ihr beruflicher Werdegang vor der Pflege?
Ich komme aus dem Zeitungswesen. Ich war Verlagskaufmann und im Vertrieb tätig – für die Ruhrzeitung.
Dann begann das große Zeitungssterben und ich musste mich umorientieren.
Es gab für mich zwei Möglichkeiten: Zum einen bot mir das Arbeitsamt an, in den EDV-Bereich zu gehen oder in einen Sozialberuf zu wechseln.
Ende der 1970 – iger Jahre wurden die ersten Ausbildungsgänge für Altenpfleger angeboten. Ich war in diesem Beruf zu dieser Zeit noch ein recht „seltenes Exemplar“.
Meine Karriere lief aber ganz gut an. Ich qualifizierte mich schnell zum Pflegedienstleiter in einem großen Pflegeheim. Gleichzeitig wurde ich stellvertretender Bundesvorsitzender der „Grauen Panther“.
Und: Ich begann mir Gedanken darüber zu machen, wie wir mehr pflege- und hilfsbedürftigen Senioren helfen konnten.
Was war das Motiv?
Ich merkte schnell im Pflegeheim, dass wir sehr stark eingeschränkt darin waren, wirklich individuell und persönlich zu pflegen.
Es fehlten die Arbeitskräfte und die dafür nötige Zeit.
Also begann ich mit 7 weiteren Kollegen ein Berufskolleg zu initiieren.
In dieser Zeit gab es noch keine ambulanten Pflegedienste. Die Pflegekassen waren strikt dagegen, dass wir einen privaten Pflegedienst gründeten und sie wollten auch keinen Verein zulassen.
Wir mussten uns für den Verein erst einmal vom Kartell-Gericht freiklagen lassen. In die Zeit fiel ebenfalls die Gründung des Bundesverbandes Ambulanter Dienste, dessen Vorsitz ich über 20 Jahre innehatte.
Würden Sie das alles heute so wieder tun?
Von der Philosophie her ja. Als Gesellschaftsform hätten wir heute sicher eine GmbH gegründet.
Was war die Initialzündung für Sie, die Freie und Alte Krankenpflege e.V. zu gründen?
Nun, ich habe das ja bereits angedeutet: Wir wollten den alten Menschen einfach bessere Leistungen geben.
Was ich in den Pflegeheimen sah, das widersprach ja schon vom Konzept her dem, was wir in der Altenpflegeschule gelernt hatten.
Es gab dort viele Hilfskräfte.
Die Mitarbeiter waren generell im Heim überfordert – physisch und psychisch. Ein System also, das sich brutal anfühlte und gegen die gerichtet war, die diese Hilfe und Pflege eigentlich brauchten.
Ich lernte in der Zeit einen Pflegekritiker kennen, der mir aus der Seele sprach. Im Unterschied zu ihm wollte ich aber nicht nur die Probleme benennen. Ich wollte verändern.
Was zum Beispiel?
Ich bin bis heute davon überzeugt, dass die Mitarbeiter zufrieden sein müssen, mit dem, was sie tun. Das strahlt aus auf die Atmosphäre in der Pflege.
Und ich wollte unbedingt eine Zeit für die Bewohner eine Pflege und Betreuung in Würde; einen Umgang, der die Biografie des Einzelnen respektiert.
Es war für mich ebenso klar, dass ich kein eigenes Heim gründen und führen wollte.
Warum nicht?
Weil die Rahmenbedingungen dergestalt waren, dass das Personal permanent überfordert wurde.
Meine Grundidee ist: Unsere Bewohner kommen hier nicht her, um zu sterben oder nur verwahrt zu werden.
Vielmehr: Sie kommen, um zu leben und für die Stärkung ihrer Lebensqualität Hilfe und Unterstützung von unserer Seite zu erfahren.
Das ist ein sehr ethischer Gedanke
Ja. Und wir leben diesen Wert. Bei uns müssen die Menschen auch nicht ausziehen – sie können in den Wohnungen und Wohngemeinschaften solange bleiben, wie sie es wollen.
Wir unterstützen die Entwicklung von Strukturen, die eine familiäre Atmosphäre im Zusammenleben fördern, die einfach den Lebensauffassungen und den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen.
Wir haben zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, in der nur Frauen leben. Es war anfangs schwer, dort eine von mir soeben beschriebene Atmosphäre zu kreieren.
Schließlich haben wir es aber doch geschafft – mit individuellen Gesprächen und spezifischen Aktivitäten. Zu uns kommen ja zum Teil Menschen, die alles verloren haben – ihre Wohnung, ihre Einrichtung.
Und da geht es zunächst darum, ihnen wieder ein Zuhause zu geben, indem sie sich wohlfühlen, das zu ihrer Heimat wird. Dazu gehört, sich das Apartment so einzurichten, wie es dem Geschmack und den Vorstellungen des Bewohners entspricht. Sicher – es sind nicht mehr so viel Möbel wie in der früheren eigenen Wohnung und es ist alle ein wenig kleiner.
Aber wir wissen: Wenn der Einzelne mitreden darf, seine Vorstellungen äußert und ein Stückchen seiner Erinnerungen in das neue Domizil mitnimmt, dann ist er auch zufrieden, beginnt sich wohlzufühlen.
Was ist Ihnen am Anfang leicht gefallen und wo hatten Sie Schwierigkeiten, hineinzuwachsen?
Das ist nicht leicht zu beantworten – was mir leicht fiel und was nicht. Das ist ja doch eher ein sehr komplexer Prozess.
Vielleicht können Sie das mal anhand eines Beispiels auflösen.
Ich komme aus der linken Bewegung. Für mich waren basisdemokratische Entscheidungen sehr wichtig.
Und so mussten sich die einzelnen Bewerber im Team vorstellen.
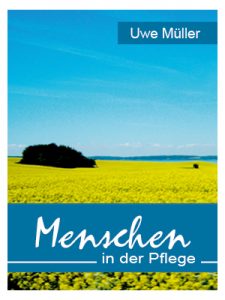
Erst wenn die Mehrheit zustimmte, dass jemand bei uns anfangen kann, haben wir den Arbeitsvertrag mit dem Bewerber geschlossen.
Irgendwann haben wir das anders gestaltet werden und diejenigen, die auch die Führungsverantwortung innehatten, entschieden über die Bewerbung. Insofern haben sich die Entscheidungsprozesse schon den Herausforderungen in der Pflegebranche angepasst.
Haben Sie das also bereut, anfangs so gehandelt zu haben?
Auf keinen Fall. Das waren wichtige Schritte und Lernprozesse.
Nur, wir konnten ja nicht stehenbleiben.
Wir wussten: Jeder im Team musste das tun, worauf er spezialisiert war und wofür er die Verantwortung trug. Das ging gar nicht anders, angesichts der wachsenden Nachfrage nach Pflege und Betreuung.
Eine wesentliche Schwierigkeit am Anfang war, dass wir keine Pflegekasse hatten, die mit uns Verträge eingehen wollte. Wir haben also unsere Leistungen privat angeboten und uns gegen Rechnung für den privaten Service bezahlen lassen.
Schließlich entschloss sich eine Kasse, mit uns Leistungsverträge abzuschließen. Nach und nach kamen weitere Kassen hinzu.
Außerdem: Wir haben im gesamten Bundesgebiet Seminare durchgeführt und mit Unterstützung des Bundesverbandes Ambulanter Dienste Menschen gewonnen, die sich in der Pflege selbstständig machen wollten.
Was macht Ihrer Meinung nach ein starkes Team aus?
Wir arbeiten in der Einrichtung schon sehr lange zusammen. Ich denke die Kontinuität, mit der wir hier Pflege und Betreuung betreiben, das macht uns stark.
Wir kennen uns sehr lange untereinander, wissen, wo wir den Anderen am besten unterstützen können. Und wir gehen in einer herzlichen, ja familiären Atmosphäre miteinander um. Da gibt es auch Kritik.
Nur ist die an Veränderungen orientiert und auf Lösungen gerichtet. Und weniger darauf, Kritik um der Kritik willen zu äußern.
Des Weiteren: Wir haben keine hierarchischen „Denke“. Wir denken und handeln mehr im Geiste der Verantwortung und dessen, was jeder für Aufgaben zu erledigen.
Also keine Anweisungen?
Doch. Die gehören dazu. Nur wir stärken die Teams darin, möglichst sehr stark eigenverantwortlich zu handeln. Das ist die beste Möglichkeit zu führen.
Führen heißt für mich, auch Dienstleister für meine Mitarbeiter zu sein.
Was macht für Sie individuelle Pflege aus?
Individuell pflegen heißt, vom Kopf und vom Herzen her zu pflegen.
Die Hilfe richtet sich nach der Anamnese – in Gesundheit und von der sozialen Komponente her.
Und: Wir lassen den Bewohnern die Freiheiten, die sie wollen und brauchen. Will jemand um 06.00 Uhr aufstehen, dann steht er 06.00 Uhr auf. Und wenn er länger schlafen will, dann respektieren wir das. Individuell betreuen heißt für die Bewohner ebenfalls: gutes Essen zu bekommen.
Wir hatten lange Zeit eine Auswahl von bis zu 7 Gerichten am Tag. Trotzdem waren die Bewohner nicht zufrieden. Und dann spielte uns der Zufall in die Hand.
Eine Bewerberin wurde als Köchin eingestellt. Sie hat den persönlichen Draht zu den Bewohnern; sie kocht weniger Gerichte, dafür aber das, was die Bewohner vorher bestimmt haben.
Was ist für Sie persönlich Glück?
Die Familie – die Kinder, die Enkel, meine Reisen; eine gute Partnerschaft, selbst gesund sein. Das gehört für mich zu meinem Glück. Ich selbst bleibe offen für Neues.
Ich empfinde es heute als ein viel größeres Glück, jemandem etwas zu schenken, als selbst beschenkt zu werden.
Meine Leben, mein Beruf – das ist für mich immer noch das größte Geschenk.
Herr Jakubiak, vielen Dank für das Gespräch.
Mehr lesen: auf das Cover klicken