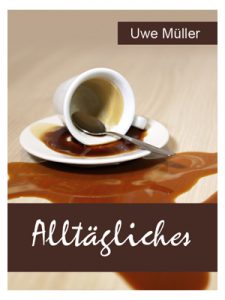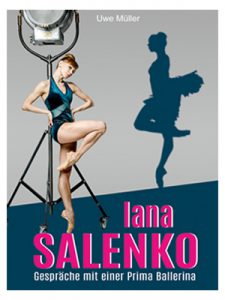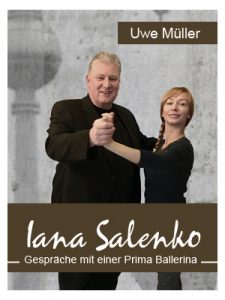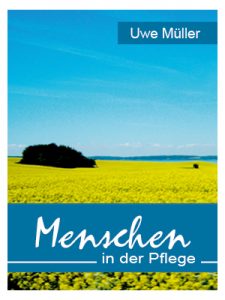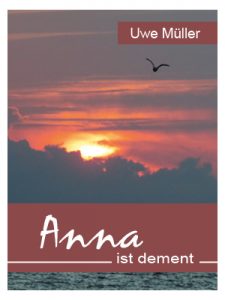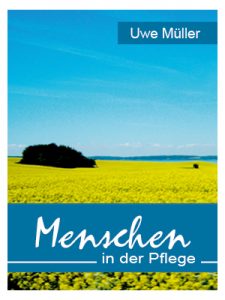
MENSCHEN IM ALLTAG-2019.03.29
Interview am 21.03.2019 - mit Martina Lippert, geschäftsführende Gesellschafterin des Pflegedienstes Martina Lippert GmbH
Einführung:
Ich habe mit Martina Lippert in den vergangenen Jahren mehrfach gesprochen. Immer wieder habe ich dabei festgestellt, dass sie zu den Menschen gehört, die nicht irgendwie mit ihrem Beruf Geld verdienen wollen.
Ich spüre bei ihr eher eine Leidenschaft für das, was sie tut. Sie spricht mit solch einer Herzenswärme von ihrem Team, und von dem, was der Pflegedienst täglich zu bewältigen hat.
In diesem Interview habe ich sie danach gefragt, welche Eindrücke sie aus dem Urlaub mitgebracht hat, wie sie die letzten zweieinhalb Jahrzehnte ihres beruflichen Tuns heute sieht. Egal ob pflegender Angehöriger, Pflege – und Hilfsbedürftiger oder einfach interessierter Leser – ich glaube, es lohnt sich, die Menschen zu kennen, zu denen man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ein engeres Vertrauensverhältnis aufbauen will oder das bereits bestehende weiter stärken möchte.
Das folgende Interview will dabei helfen.
Frau Lippert, Sie haben kürzlich eine Reise mit dem Wohnmobil unternommen. Eine gute Gelegenheit, berufliche Dinge mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Vor diesem Hintergrund wäre meine erste Frage an Sie:
Was ist Ihnen in einer der ruhigen Momente zuerst eingefallen, wenn Sie an die letzten 25 Jahre als Pflegedienstinhaberin gedacht haben?
Alles richtig gemacht.
Was haben Sie richtig gemacht?
Es war ein großes Glück, dass ich alles selbst gestalten konnte. Natürlich war es anfangs schwer für mich, sehr schwer. Ich musste ja nicht nur fachlich die Sache im Griff haben, sondern auch die administrative, die kaufmännische Seite. Das war für mich anfangs besonders schwer.
Noch einmal zurück zu Ihrem Urlaub: Was waren denn Ihre Highlights?
Wir sind über Maastricht, Luxemburg bis nach Barcelona gefahren und dann die Straße von Gibraltar am Mittelmeer weiter. Wir waren zum Beispiel in Tarifa, Spanien einem Hotspot für Kitesurfer.
Da habe ich Menschen gesprochen, die nicht mehr nach Deutschland zurückmochten. Sie wollten ihre Probleme hinter sich lassen. So sehr ich da manchen verstanden habe, so sehr war ich froh, dass ich mich doch in meinem Leben durchgebissen und nicht aufgegeben habe, trotz mancher Schwierigkeiten.
Aber man bekommt dort eine bestimmte Art der Gelassenheit, was wiederum schön ist, wenn man zur Ruhe kommen will.
Das war schon eine andere Welt. Manchmal habe ich gedacht, warum ich nicht einfach dort bleibe.
Warum haben Sie das gedacht?
Wenn Sie zum Beispiel Zuhause mit Menschen zu tun haben, die Sie fragen, warum sie nicht sterben dürfen, dann ist das schon eine Welt, die auch sehr belastet, psychisch und mental.
Ist das aber nicht auch ein Grund zurückzukommen, weil Sie wissen, dass die Menschen Sie brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man helfen kann und wenn es nur ein tröstendes Wort ist, dann ist das immer gut.
Wie lange waren Sie unterwegs?
Insgesamt 10 Wochen. Wir waren zu zweit unterwegs. Meine Reisefreundin mit einer jungen Schäferhündin und ich mit meinem Ursus, einem Cocker Spaniel. Das war natürlich auch manchmal stressig.
Aber dann ist es umso erfreulicher, wenn man wieder die eigene 120 qm Wohnung zu Hause betritt.
Was haben Sie vermisst, als Sie wieder zu Hause waren?
Die Gelassenheit, die wir unterwegs angetroffen haben. Zum Beispiel in Benidorm, einem Badeort an der der Costa Blanca. Das war schon ein Traum, auch wenn es heute nicht mehr das kleine und verträumte Fischerdorf ist.
Und was tut Zuhause wieder gut?
Das Leben ist hier strukturierter, organisierter. Ich habe auch das Gefühl, wieder da zu sein für meine Mitarbeiter und meine Kunden, die auf mich gewartet haben und die mich brauchen.
Was hat sie am meisten in den letzten 25 Jahren geprägt?
Mich haben Menschen geprägt, denen ich helfen konnte, und denen ich beruflich weiterhelfen konnte. Zum Beispiel war da eine junge Frau, die Reinigungskraft werden wollte, um Geld zu verdienen.
Ich habe sie motiviert, zweimal in der Woche in die Abendschule zu gehen und sich zur Pflegehelferin ausbilden zu lassen. Später haben wir sie in unserer Seniorenwohngemeinschaft als Hauswirtschaftskraft eingestellt. Und heute ist als Pflegekraft in einem Pflegeheim tätig.
Das war vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber ich bin noch heute stolz darauf. Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen, sie ein Stück ihres Weges begleiten und zu fördern, darin sehe ich meinen Lebenssinn.
Lassen sich denn alle helfen?
Leider nein. Ich denke, dass manche Menschen einfach zu früh aufgeben. Das ist auch das, was mich heute am meisten stört, nämlich wenn einige zu früh aufgeben oder sich von vornherein in die „Hängematte“ legen, einfach ihre Chancen nicht nutzen. Für mich war es stets wichtig, gerade nicht aufzugeben, wenn es hart auf hart kam.
Können Sie das noch ein wenig näher erläutern?
Ich komme aus einem Elternhaus, indem mein Vater als Maschinenschlosser gearbeitet hat. Er war in der Autobranche tätig. Wir waren vier Mädchen Zuhause.
Ich hätte sehr gern den Beruf des Autoschlossers erlernt. Das war damals nicht möglich. Für Mädchen gab es diese Option nicht. Also ging ich arbeiten, um Geld zu verdienen. Geld für meine Ausbildung, die ich absolvieren wollte.
Welche Ausbildung?
Eine zur Krankenschwester. Ich bin also nach Menden gefahren und habe als vierzehnjähriges Mädchen in einem Betrieb gearbeitet, in dem Stahlstangen gefertigt wurden.
War das nicht physisch schwer?
Ja, sehr schwer. Aber es hat mich geprägt, nämlich mein Ziel nicht aus den Augen zu lassen
Wie ging es weiter?
Ich wollte danach in einem evangelischen Krankenhaus eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren. Mein Vater aber wollte, dass ich die Ausbildung in einem katholischen Krankenhaus durchlaufe.
Und wer hat sich durchgesetzt?
Ich, mit Unterstützung meiner Mutter. Ich habe am 01.10.1975 meine Ausbildung in Iserlohn begonnen, obwohl ich erst 17 Jahre alt war und die Zustimmung meiner Eltern brauchte.
Also hätte mein Vater auch gut diese Zustimmung verweigern können.
Was ist Ihnen heute wichtig, wenn Sie an die Zeit zurückdenken?
Ich habe es geschafft und bin meinen Weg gegangen. Ich wollte es besser machen, mein eigenes Geld verdienen.
Wenn Sie mal die heutige Zeit mit der von vor nahezu dreißig Jahren betrachten, was bleibt bei Ihnen besonders prägnant im Gedächtnis?
Naja, heute habe ich manchmal den Eindruck, dass viele mit Samthandschuhen angefasst werden.
Wie ist das zu verstehen?
Also, ich bin natürlich für einen fairen Umgang mit Mitarbeitern und Auszubildenden. Das schließt aber ein, nicht nur miteinander höflich umzugehen, was mir übrigens sehr wichtig ist.
Nein, wir müssen stets das Verhältnis von Fördern und Fordern im Blick haben und hier nicht zu schnell aufgeben. Einfach dranbleiben an den Menschen und ihren Problemen und ihnen aufzeigen, was es für sie bedeutet, wenn sie sich nicht anstrengen. Dass sie sich selbst ihre Zukunft verbauen.
Und, hatten Sie damit Erfolg?
Insgesamt schon. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und wenn sich jemand nicht helfen lassen will, den Anforderungen nicht entsprechen will, dann sind uns auch die Hände gebunden, denn wir müssen die hohen Standards in der Pflege und Betreuung einhalten. Das heißt vor allem, alles für die eigene Qualifikation zu tun.
Wir helfen immer, da wo wir können. Aber wenn jemand partout nicht will, dann haben wir auch keine Chance, ihn zu fördern.
Was hat sich noch verändert?
Früher konnten Sie also mit dem sogenannten hanseatischen Handschlag Geschäfte machen. Heute müssen Sie zum Kunden ca.15 Seiten mitnehmen, die er unterschreibt, damit der Prozess bei der Krankenkasse überhaupt in Gang gesetzt werden kann.
Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie die letzten 25 Jahre zurückblicken?
Dass ich geschäftlich überlebt habe. Bei der Zulassung sagten mir Mitarbeiter aus der Krankenkasse, dass es sich mit mir ohnehin nach einem halben Jahr erledigt hätte.
‚Totgesagte‘ leben eben länger, wie so schön heißt. Bei allem Frust, der natürlich manchmal entsteht, wenn man mit der Bürokratie zu kämpfen hat, was bleibt, das ist die Freude im Umgang mit den Menschen.
Wie erholen Sie sich von stressigen Ereignissen?
Indem ich am besten in Lingen mit Ursus, meinem Cocker Spaniel spazieren gehe.
Frau Lippert, vielen Dank.

Mehr lesen: https://uwemuellererzaehlt.de/ueber-menschen-erzaehlen/menschen-im-alltag-2021/