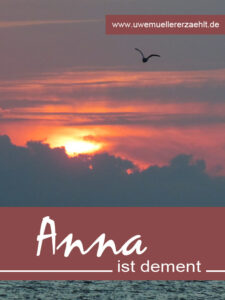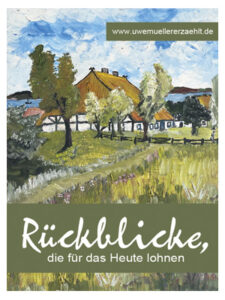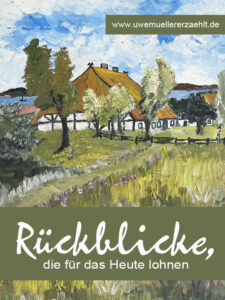PETER ERINNERT SICH (3)
WAS BISHER WAR:
„Leinen los“, hieß das Fotoalbum, das sich Peter mit Anna gemeinsam anschaute, während Klara mit der Pflegerin im ‚Betreuten Wohnen‘ besprach, was Anna noch an Sachen brauchte.
Anna war wieder in ihre frühere Welt eingetaucht. Sie sah auf den Bildern das Schiff, mit dem sie die schöne Reise nach St. Petersburg und Danzig gemacht hatte, und sie fühlte sich gut dabei, das alles gemeinsam mit Peter anzuschauen.
Peter taten bereits die Knie weh, weil das Fotoalbum so schwer war, das auf seinen Beinen lag.
„Na, schaut ihr schön die Fotos an?“, fragte Klara, die von dem Gespräch mit der Betreuerin zurückgekehrt war.
Peter fühlte sich beim Spielen ertappt, so als hätte er gerade unter dem Tisch gesessen und mit Klammern gespielt.
Dabei hatte er das Album auf Geheiß von Klara herausgeholt.
„Oh ja, wir spielen schön“, sagte Peter mit leicht beißendem Spott, denn er wäre lieber sofort aus dem Zimmer gegangen, hätte sich auf den Balkon gestellt und in die Ferne geschaut.
„Du kannst ja jetzt mit deiner Mutter die Bilder weiter ansehen“, schob Peter hinterher.
Klara schaute ihn strafend an. Ich muss noch mal los und ein paar Sachen besorgen.
„Wieso musste du Sachen besorgen?“, fragte nun Anna.
„Mutti, ich zeig‘ dir nachher, wenn ich wiedergekommen bin, was ich geholt habe.“
Anna zog die Mundwinkel nach unten, so als wollte sie sagen: „Das verstehe ich nicht.“
Sie verstand es ja auch wirklich nicht. Bevor die Fragerei von Annas Seite aber weiterging und Klara nicht zum Einkaufen loskam, blätterte Peter mit einem Seufzer eine Seite im Fotoalbum um und zeigte auf ein Foto: „Was steht da unten?“
„Beim Kapitänsempfang“, sagte Anna wie aus der Pistole geschossen.
„Weisst du Peter, ich durfte mit am Tisch vom Kapitän sitzen“, sagte Anna.
„Der wird ja dafür bezahlt, dass er mit dir an einem Tisch Platz nimmt.“
„Bezahlt? Der wird doch nicht bezahlt!“, sagte Anna und schaute Peter missbilligend an.
Gut, dass Klara gerade nicht da war. Sie hätte ihm schon wieder einen Schubs gegeben, damit er seine Bemerkungen ließ.
„Nein“, sagte Peter, „das war nur ein kleiner Scherz.
„Wer ist das denn hier auf dem Foto?“
„Das ist ja Annemarie. Du, die war oft mit. Die fuhr so gern mit mir.“
„Und du nicht mit ihr?“, fragte daraufhin Peter.
„Wie meinst du das?“, Anna zog die Augenbrauen hoch.
Peter sah ein, dass er so nicht weitermachen konnte und sich zusammenreißen musste.
Was musste das für eine Kraftanstrengung für die Pflegekräfte, sich jeden Tag wieder aufs Neue mit den Heimbewohnern zu beschäftigen, ohne dabei die Freude am Umgang mit den Menschen, die sie betreuten, zu verlieren.
„Abschied zu Lebzeiten: Wie Angehörige mit Demenzkranken leben“ (Inga Tönnies) Einfach selbst informieren und dazu auf den Button 'ansehen' gehen:

„Ich muss mal kurz nach draußen und frische Luft schnappen“, sagte Peter und ging schnell aus dem Zimmer.
Am anderen Ende des Ganges kam ihm ein junger Mann entgegen, der einen Rollstuhl mit einer Heimbewohnerin schob.
„Guten Tag“, rief der Peter sehr freundlich zu, fast ein bisschen schleimig.
Jetzt erinnerte sich Peter. Das musste Klaus-Peter Matschig sein.
Das Personal nannte ihn hinter seinem Rücken ‚Matschi, die Nervensäge‘.
Und das hatte seinen Grund.
Für Peter war es ein Rätsel, woher die Leute die Zeit nahmen. Matschi kam jeden Tag und blieb mehrere Stunden, in denen er sich um seine Mutter kümmerte.
Das war schön, aber musste er nicht auch arbeiten?
Klara hatte ihm erzählt, wie Matschi auf einer Versammlung sämtliche Missstände angeprangert hatte, die es seiner Meinung nach im Betreuten Wohnen gab.
„Meine Mutter erhält nicht genügend Aufmerksamkeit von Ihnen“, hatte er ausgeführt und die Pflegekräfte gemeint.
„Das kann ich nun gar nicht sagen“, hatte Klara daraufhin entgegnet. Wenn Sie mal nicht da waren, dann war stets eine Mitarbeiterin bei Ihrer Mutter“, sagte Klara zu ihm.
„Finden Sie nicht auch, dass Sie mal was Positives sagen können, vielleicht eine winzige Kleinigkeit, die Ihnen positiv aufgefallen ist?“, fragte Klara ihn.
Matschi war verblüfft und bekam kein Wort heraus, während die Pflegedienstleiterin sie dankbar ansah.
Klara war auch dafür, Mängel anzusprechen, aber Dinge herbeizureden, die nicht der Realität entsprachen, das fand sie unfair gegenüber den Pflegekräften, die es schwer genug hatten, die Bewohner in jeder einzelnen Sekunde nicht aus den Augen zu lassen.
Für Matschi war das alles selbstverständlich und er bekam auch kein Dankeschön über die Lippen.
Klara war froh, dass Peter nicht dabei gewesen war. Er hätte wahrscheinlich zum grossen Schlag ausgeholt, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.
Auf zerschlagenes Porzellan konnte er solchen Momenten keine Rücksicht nehmen, denn das war nicht seine Stärke.
Peter wusste genau, dass er sensibler vorgehen müsste, aber ihn empörte meist die Gleichgültigkeit von manchen Angehörigen, die nicht sahen, wie sehr sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen demotivierten.
„Na, wie war deine Besprechung mit der Schwester?“, fragte Peter, als Klara und er das Gebäude wieder verliessen.
„Ach, es ging nur um organisatorische Dinge“, antwortete sie und Peter gab sich damit zufrieden.
Auf der Autobahn Richtung Berlin schwiegen sie lange.
Es war bedrückend zu sehen, wie Annas geistige Fähigkeiten von Mal zu Mal schrumpften und sie nichts dagegen tun konnten.
Sie würden immer mal wieder hinfahren und nach dem Rechten sehen.
Ein kleiner Lichtblick war es für Peter, dass Anna merklich auflebte, als er mit ihr die Bilder im Fotoalbum angeschaut hatte.
MEHR LESEN: AUF COVER KLICKEN